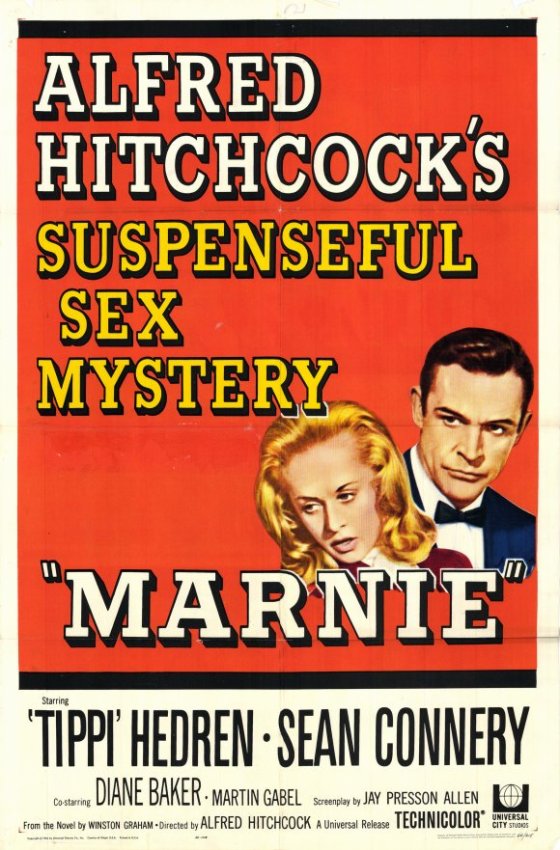100 Beiträge in nicht ganz zwei Jahren sind schon ein Anlass zum Feiern, oder? Hab mir die letzten Tage den Kopf zerbrochen, wie das adäquat zu zelebrieren wäre, und fand in meinem Archiv einen Eintrag vom 22. April 2008, meinem vorletzten Tag in Südafrika. Ich entschied, den 100. Beitrag hier ein wenig privater zu fassen, als ich es üblicherweise tue, und von meinem Aufenthalt in Namibia und Kapstadt zu schreiben.
Seit meinem 14. Lebensjahr schien Namibia zu rufen: »Komm zurück! Komm zurück!«, als wäre ich in einem früheren Leben bereits dort gewesen. Etwas zog mich, es war wie ein Magnet, ein mächtiger Sog. Bis ich kurz nach meinem 30. Geburtstag den sandigen Boden Namibias betrat, vergingen fast 16 Jahre, in denen ich mir immer wieder neue Reiseführer, Landkarten und Bildbände kaufte. Wilhelminische Eleganz in der Wüste, Jugendstilhäuser am Atlantik. Die Vermischung deutscher, britischer und traditioneller afrikanischer Einflüsse faszinierte mich. Zehn Flugstunden gen Süden, und kleine farbige Kinder begrüßen einen auf Schwäbisch.
Leider führte ich während meines Aufenthalts in Namibia und Kapstadt kein Reisetagebuch, und ausgerechnet beim Ausflug zum Waterberg und zum Etosha-Nationalpark streikte der Fotoapparat: ich hatte den Akku in der Lodge in Ermangelung einer Steckdose nicht aufladen können. So muss ich mich nun auf mein abstraktes Gedächtnis verlassen.

Am Tag vor meiner Abreise wurde ich verlassen. Nach einer längst überfälligen Trennung zum Jahreswechsel 2007/08 hatte ich mich völlig hirnverbrannt in eine merkwürdige Affäre mit einem Hamburger Modejournalisten gestürzt; nach kaum acht Wochen saßen wir gemeinsam im Standesamt Neukölln und bestellten das Aufgebot. Bald darauf bekam er — so nehme ich an — kalte Füße, sein Ex zog wieder bei ihm ein, und er servierte mich per SMS ab. Mein erster Urlaub nach über zwölf Jahren stand somit schlagartig unter einem unschönen Stern, den Großteil der Reise verplemperte ich mit Tränen und Grübeleien.
Berlin — Hildesheim — Frankfurt — Windhoek. Von Windhoek mit dem Bus über Okahandja nach Swakopmund, das irgendwer mal als das »südlichste deutsche Nordseebad« bezeichnet hatte. Was für ein Erlebnis! Die Wüste trifft auf die tosenden Wellen des Atlantiks, die Straßen und Geschäfte tragen deutsche Namen, das Moltkehaus ist ein Jugendstiljuwel unter klarblauem Wüstenhimmel. 1892 waren hier etwa 40 deutsche Siedler an Land gegangen, um einen Hafen zu gründen, der Deutsch-Südwest vom britischen Walvis Bay unabhängig machen sollte. Die starke Brandung und der flache Strand zwangen die Schiffe, weit vor der Küste zu ankern, und dennoch stampfte das Deutsche Reich unter enormem Einsatz finanzieller Mittel, Menschenleben und Soldaten eine wilhelminische Stadt mit prächtigen Jugendstilbauten aus dem Sand. Heute ist Swakopmund ein beliebtes Seebad, in den Sommermonaten strömen die Leute aus dem etwa 400 Kilometer entfernten Windhoek hierher, um sich am Meer abzukühlen. Diese Stadt strahlt etwas Unwirkliches aus. Als Dessert servierte man im Swakopmund Hotel die schmackhafteste Schwarzwälderkirschtorte, die ich je gegessen hatte. Ich wäre gerne länger dort geblieben. Direkt hinter der Stadt erstreckt sich eine Mondlandschaft von mehreren hundert Kilometern. Da die salzige Luft und die Hitze normale Teerstraßen in kürzester Zeit zerfressen, sind die Straßen aus Salz.

In Khorixas und Outjo waren wir in Lodges untergebracht. In der iGowati Lodge im Damaraland aß ich zum ersten Mal Antilopenfleisch. In den kleinen Hütten gab es keinen Strom. Die Dunkelheit und die Stille, die einen hier des Nachts umfassen, sind beinahe magisch. Vom Nachthimmel regnete es Licht: ein Sternenregen, die Plejaden. Eine warme Schwärze, die einen liebkost, und die säuselnden Geräusche der (noch weitestgehend unberührten) Natur wiegen einen in einen köstlich-ergiebigen Schlaf. Im Vergleich zu diesem Schlaferlebnis waren die Ausflüge zum Etosha-Nationalpark, dem Versteinerten Wald und Twyfelfontein fast uninteressant. Im April ist es in Namibia bereits Herbst, man sieht verhältnismäßig wenige Tiere. Von weitem erblickten wir aus dem Bus einige Schabrackenschakale, Zebras und Giraffen, sogar ein einsamer Elefant rieb sich an einem Baum, aber viel mehr gab es in Etosha nicht zu entdecken.
Unweit von Khorixas befindet sich die Fingerklippe. Die Aussicht über die Berglandschaft überwältigte mich. Das Schönste: ich brauchte diesen Anblick mit niemandem zu teilen. Kein Fotoapparat kann diese Weite, die Schönheit, diese Gewaltigkeit einfangen. Ich war ganz allein mit mir und dieser Welt. Niemals zuvor oder seither habe ich so weit gesehen. Wie winzig klein wir doch sind, und wie groß und wunderbar diese Welt! Auch heute, fast vier Jahre später, finde ich keine Worte, die diesen Ort angemessen beschreiben würden, aber die Eindrücke nisteten sich tief in mir ein, ich werde sie nie verlieren, solange ich lebe.
In Windhoek trafen wir genau rechtzeitig zum Karnevalsumzug ein. Wie in Mainz oder Köln schlängelte sich ein großer, bunter Festtagszug durch die Independence Avenue. Der Tintenpalast gefiel mir gut, und während die anderen aus der Reisegruppe abends Krokodil aßen, genehmigte ich mir wieder ein Kudusteak. Ich halte nichts davon, in der Nahrungskette unnötig weit nach oben zu klettern. Krokodil, Schlange oder Hai werde ich nie essen! In Namibia gelten übrigens noch die alten Öffnungszeiten, wie ich sie als Kind noch kannte: Von 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr sind die Geschäfte geöffnet, samstags ist ab spätestens 14:00 Uhr alles dicht. Die Hauptstadt wirkt am Wochenende wie ausgestorben. Das verhinderte auch größere Souvenireinkäufe, ich brachte recht wenig aus Namibia mit.

Am 13. April flog ich von Windhoek nach Kapstadt. Die Schilderung meines zehntägigen Aufenthaltes dort erspare ich Euch. Ich machte die üblichen Stadtrundfahrten mit, besuchte das South African Museum, das alte Sklavenhaus, das District Six Museum, eine Kirche, den Tafelberg, Kirstenbosch, das Kap der Guten Hoffnung, eine Seehundkolonie, Simon’s Town, Stellenbosch, Franschhoek und natürlich das Aquarium in der Nähe der Victoria & Alfred Waterfront. Ich muss sagen: Stellenbosch und Franschhoek haben mir am besten gefallen.
Hier nun der Eintrag vom 22. April 2008:

Der letzte Abend. Brainstorming.
Kapstadt — oder Mother Town, wie die Einheimischen es nennen, weil es die älteste Stadt Südafrikas ist — hatte heute wieder einen seiner sehr beliebten Stromausfälle. Die kommen im Schnitt wohl alle zehn bis 14 Tage vor, dauern zwei bis drei Stunden und haben unterschiedliche Ursachen. Meist stellt die Stadt den Strom unangekündigt in dem einen oder anderen Bezirk ab, weil irgendwelche Leitungen überprüft oder überholt oder ausgewechselt werden müssen. Die Auswirkungen sind nicht unbedingt lustig, zum Beispiel für das Ehepaar, das heute in unserem Hotel fast drei Stunden im Lift ausharren musste. Die Geschäfte konnten quasi dicht machen, weil ohne Strom ja auch die Kassen nicht einsatzfähig sind, und was auf den Straßen los war, war leider überhaupt nicht komisch. Berufsverkehr in einer Millionenstadt, keine Ampeln und kaum ausreichend Verkehrspolizisten. Ich durfte erstmals die 13 Stockwerke zu meinem Zimmer per pedes erklimmen. Das hatte ich mir auch erotischer vorgestellt. Fix und fertig kam ich oben an, und ich bin Nichtraucher! Klimaanlage wär auch willkommen gewesen. (Die ratterte gut zwei Stunden später lustvoll los, als ich gerade im Tiefschlaf auf meinem Bett die Dämmerung ersehnte.)
Morgen um 13:30 Uhr steht der Bus vorm Ritz — und ab geht’s zum Flughafen. Cape Town — Windhoek — Frankfurt. Der letzte Abend also. Letzten Endes ging es doch sehr rasch vorbei.
Gegen 17 Uhr — der Lift funktionierte wieder — entschloss ich mich, noch einmal den langen Spaziergang die Küste entlang zu machen. Die Promenade, die direkt zur Waterfront führt. Bei klarem Wetter kann man bis nach Robben Island schauen. Die großen Schiffe, die majestätisch durch die Bucht ziehen, sehen im Sonnenuntergang wie gemalt aus. Der Himmel spannt sich kaleidoskopisch orange, violett, tiefrot, hellblau und golden über den Atlantik, und die Wellen rollen laut rauschend auf die Küste zu, sehr zur Freude der Kanufahrer und Surfer, deren Mut man angesichts der schroffen Klippen, der eiskalten Wassertemperaturen und starken Unterströmungen man nur bewundern kann. (Seit ich im Aquarium gesehen habe, was sich so im Kelp Forest vor der Küste an Getier tummelt, ist mir die Badelust übrigens gehörig vergangen.)
Die vergangenen Tage ging ich viel hier spazieren, das heißt: ich schlenderte. Stundenlang. Es flossen viele Tränen an dieser Küste. Aber ich erlebte auch Schönheit und fasste wichtige Entschlüsse während meiner Meditationsausflüge. Ein ausgewogenes Programm. Einmal, am Freitag, fuhr ich mit dem Bus nach draußen zum Strand und lieh mir ein Pferd — einen Schimmel —, um zum ersten Mal in meinem Leben frühmorgens an einem Sandstrand entlang zu reiten. (Wenn das Pferd den Trab beherrscht hätte und nicht wie wild los galoppiert wär, hätte das ein richtig tolles Erlebnis werden können.) Was für eine enorme Wirkung das Meer auf mich hat (und immer schon hatte); es wühlt mich auf und beruhigt mich zugleich. Ich kann die Augen schließen und ihm einfach zuhören, mich hingeben. Es scheint seine eigene Sprache zu haben, eine Form von Musik: gleichmäßig rauschend, kraftvoll krachend, gurgelnd und, ja, kichernd. Diese Ruhe und dabei diese ungeheure Gewalt, die sich durch nichts und niemanden zähmen lässt, das erzeugte bei mir schon früh eine tiefe Ehrfurcht.
Wie üblich war die Promenade belebt, als ich mich heute auf den Weg machte. Die Jogger, die Leute mit ihren Hunden, die Touristen, die Surfer — und das Meer, das Akteur und Bühne zugleich war. Tosend zerschellten die großen Brecher an der Mauer, schäumend spritzte die Gischt meterhoch über die Brüstung, dann rauschte das Wasser in kleinen Bächlein zurück, und die Steine, die von ihm bewegt wurden, klangen wie Rasseln. Ich lauschte ganz bewusst, nahm die Musik des Meeres auf wie ein Schwamm, und auch die visuellen Schönheiten dieses Abends wollte ich voll konzentriert und klar in mich aufnehmen. Oft hielt ich inne, blickte hinaus, blickte hinab, wanderte ganz nah an der Brüstung entlang, ließ die Gischt hinter, vor und über mir aufs Land klatschen und war ganz und gar bei mir. Ich fühlte mich eins mit mir und den sinnlichen Eindrücken um mich herum. (Kann man von einem sexuellen Erlebnis sprechen?) Wie üblich kam der salzige Wind frisch und kräftig über die See gefegt, die Spazierenden kühl ummantelnd, liebkosend. Und dann…
…sah ich die beiden, die ich seit meiner Ankunft hier gesucht zu haben schien.
Er saß auf der Brüstung, die Beine gespreizt, in einer unvermutet femininen Pose. Sie stand vor ihm, wie normalerweise der Mann vor der Frau steht — zumindest würde man das in einem Film oder auf einer Postkarte so darstellen —, ihre Hüften zwischen seinen Knien, ihre Arme um ihn geschlungen, ihn haltend, ihren Kopf zwischen seinem Kinn und der Brust liegen habend. Behutsam, als wäre sie zerbrechlich, strich er über ihre Wange und durch ihr Haar, und sie redete mit ihm, sie redete langsam, die Worte weich auskostend, in diesem niedlichen Englisch, das man hier unten spricht. Die beiden waren von einer so unsagbaren Schönheit, ich hätte sie malen wollen. Ich verharrte, konnte den Blick nicht abwenden.
Ihre Haut war so dunkel und delikat wie ein frisch poliertes antikes Möbelstück aus Ebenholz, und man konnte sehen, wie weich sie war. Der langsame, fast behäbige Tanz ihrer Hände, die einander liebkosten, fesselte mich. Ein salziger Geruch in der Luft, ein kurzes Auflachen, ein Kuss auf die Nasenspitze.
Im Vorbeigehen lächelte ich die beiden an, und sie strahlten zurück.


Das war er also, mein letzter Urlaub. Direkt im Anschluss ging es damals nach London, Proben für »Twelfth Night«. Seither arbeite ich 330 Tage im Jahr. Warten wir mal ab, wie lange das noch gut geht.
Namibia ist für mich noch nicht vorbei. Die »Komm zurück! Komm zurück!«-Rufe verstummen nicht. Vielleicht wird sich eines Tages noch einmal die Möglichkeit ergeben, das Land intensiver zu erleben. Überhaupt ist da eine brennende Sehnsucht nach Afrika, nicht zuletzt seit Barbara Kowas Film »Dreaming Mali« und den Bildern, die ich von Pomene Bay und Johannesburg gesehen habe. Nun, wir werden sehen.
Heute ein etwas wehmütiger Gruß…
André